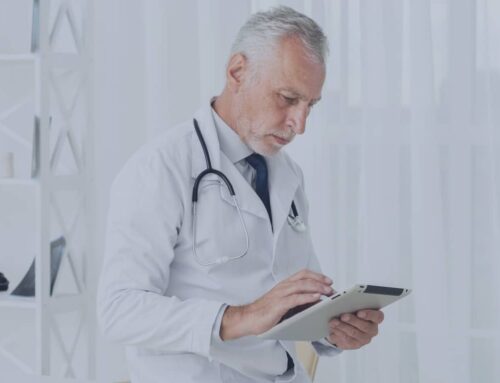Das „Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“, kurz E-Health-Gesetz, schreibt eine sukzessive Einführung einer Telematikinfrastruktur im deutschen Gesundheitswesen vor. Ziel ist es, alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen miteinander zu vernetzen und somit die sektorenübergreifenden Kommunikationsmöglichkeiten sowie den Transfer von Gesundheitsdaten effizienter zu gestalten. Die Umsetzung scheiterte jedoch zunächst vor allem aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken und der großen Ablehnung der eGK auf Seiten der Ärzte. Was bleibt vom angekündigten Digitalisierungsschub für das deutsche Gesundheitswesen? Welche Alternativen haben Krankenhäuser und Versorger, um Datenaustausch, Prozesse und Patientenversorgung digital und sicher zu optimieren?
Elektronisches Datenmanagement im Gesundheitswesen- Fahrplan, Fristen und die Realität
Mit dem „Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“, kurz E-Health-Gesetz, soll der alte Ablauf in Arztpraxen und Krankenhäusern einen Sprung in das digitale Zeitalter machen. Die 2004 mit dem GKV-Gesundheitsmodernisierungsgesetz geplanten elektronischen Gesundheitskarten, fanden 2006 Ablehnung auch durch die Ärzte, die vor allem Bedenken bezüglich des Datenschutzes äußerten. Im Dezember 2015 wagten Bund und Länder einen erneuten Versuch und führten ab dem 1. Januar 2016 die Telematikinfrastruktur (TI) ein. Damit verschob sich der Fortschritt im Gesundheitswesen um 10 Jahre. Um den Anschluss an die TI voranzutreiben, wurde den Ärzten eine Frist bis Juli 2018 gestellt. Auch waren Sanktionen im Fall einer Nichteinhaltung vorgesehen. Die strikteren Maßnahmen scheiterten jedoch nicht am Widerstand der Ärzte. So war die gematik erst im November 2017 in der Lage, erste Zulassungen für Komponenten und Equipment zu vergeben. Dies machte eine Belieferung aller Nutzer unmöglich, eine erneute Fristverlängerung um sechs Monate war die Folge. Am 30. Juni 2019 liefen zuletzt einige Fristen aus. Seitdem verläuft der Anschluss der Praxen an die Telematikinfrastruktur schneller aber immer noch schleppend. Der Grund: Wenige Zulassung von Geräten, hohe Unsicherheit gegenüber der Technik und hohe Kosten. Das „Digitale Versorgungsgesetz“ hat die Frist für Kliniken ab Beginn 2020 um 12 Monate verlängert.

Die elektronische Gesundheitskarte
Datenkarten kommt als Schnittstelle zwischen digitaler und analoger Welt auch im Gesundheitswesen eine Schlüsselposition zu. Die Vorteile einer digitalen Datenverarbeitung versprechen dabei eine Reduzierung von Ressourcen, effizientere Prozesse in Krankenhäusern und Praxen sowie eine stärker auf den Patienten fokussierte Versorgung. Bereits 2006 scheiterten erste Ansätze und Testphasen zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte im Gesundheitswesen. Mittlerweile werden Datenzugriffe und -verarbeitung über die eGK unter Auflagen gewährt. Trotzdem erklären Kritiker das milliardenschwere Projekt für gescheitert, da die Technologien nicht den modernen Standards entsprechen.
Dennoch besitzt die elektronische Gesundheitskarte in ihrer Vielseitigkeit Potential. Medikationspläne, die den behandelnden Ärzten Aufschluss darüber gibt, welche Medikamente der Patient bereits zu sich nimmt, wären ebenso schneller abrufbar wie ein ausgestellter eArztbrief. Auf einen Medikationsplan hat jeder Patient Anrecht, wenn ihm mehr als drei Medikamente verabreicht werden. Die elektronische Alternative ersetzt nicht den Anspruch des Patienten auf eine ausgedruckte Version. Selbst das Notfalldatenmanagement, welches im Ernstfall lebensrettend sein kann, profitiert durch die Effizienz der eGK.
Versichertenstammdatenmanagement
Im Laufe der Jahre sammeln sich für jeden Patienten unzählige Daten an. Laut der Deutschen Apothekerzeitung geht der Deutsche durchschnittlich 17 Mal pro Jahr zum Arzt. Auf ein Leben hochgerechnet sind die anfallenden Datenmengen enorm. Hinzu kommen Überweisungen, Rezepte, Krankheitsverläufe, Krankschreibungen und weitere den Patienten individuell betreffende Daten.
Auf Grund dessen hat sich die Regierung 2016 auf eine viermonatige Testphase geeinigt. Im Fall eines erfolgreichen Tests, sollte die Praxis des Stammdatenabgleiches als gängige Methode bis zum 01. Juli 2018 eingeführt werden. Da die Fristverschiebung diesen Terminplan verwarf, verschob sich auch diese Frist auf Januar 2019.
Fernbehandlung durch Videosprechstunde
Seit dem 31.03.2017 dürfen Vertragsärzte unter gewissen Voraussetzungen Videosprechstunden anbieten und abrechnen. Dies dient zum einem dem Schutz des Personals, beispielsweise bei Infektionskrankheiten wie COVID-19 oder der Grippe. Zum anderen können mit dieser Vorgehensweise auch stark erkrankte Patienten geschont werden. Beispielsweise wenn diese nur schwer transportfähig sind.

Die elektronische Patientenakte (ePA) und das Patientenfach
Ab dem 01.01.2021 haben Patienten Anspruch auf zwei weitere Formen der Datenhinterlegung.
Mit Hilfe der elektronischen Patientenakte (ePA) können elektronische Daten in Form von Arztbriefen, Medikationsplänen, Impfausweisen oder auch Notfalldaten gespeichert und verwaltet werden. Allerdings werden Impfpass, Mutterpass so wie etwaige andere erst ab 2022 in der elektronischen Patientenakte einsehbar sein. Die Hoheit der Datenverwaltung liegt dabei beim Patienten. Im elektronischen Patientenfach werden die Daten der ePA widergespiegelt. Dieses wurde mit dem Terminservice und Versorgungsgesetz mit der elektronischen Patientenakte zusammengeführt. Doch auch persönliche Gesundheitsdaten (z. B. Ernährungs- oder Bewegungsdaten) können vom Patienten eingetragen werden.
Neuerungen durch das Digitale Versorgungsgesetz
2019 trat zusätzlich zu dem „Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“ das „Digitale Versorgungsgesetz“ in Kraft. In diesem setzt sich der Gesetzgeber mit den Neuerungen der Digitalisierung, wie Gesundheitsapps, auseinander. Diese müssen beispielsweise vor ihrer Verwendbarkeit registriert werden. Um diese Neuerungen außerdem zu fördern ist eine Investmentförderung für Innovationen beschlossen worden. Aber auch die Telematikinfrastruktur ist von den Neuerungen betroffen und mit ihr alle beteiligten Parteien. Die Datenverarbeitung wie auch die Datentransparenz stehen ebenfalls im Mittelpunkt der Neuerungen, so auch als neuestes Konzept das eRezept. Mit diesem soll die unübersichtliche und intransparente Rezeptwirtschaft überwunden werden. Diese sollen ebenfalls digital verfügbar werden. Der erweiterte Gesetzestext ist hier zu finden.
Sinnvoll modernisieren und digitalisieren!
Von hoher Priorität ist häufig nur das, was Krankenhäuser wie Versorger langfristig entlastet. Würden die genannten Konzepte über die elektronische Patientenakte umgesetzt, wäre dies eine wesentliche Erleichterung und ein Flexibilitätsgewinn. Die Wartefrist bei der Überweisung eines Patienten zu einer anderen Einrichtung würde reduziert, da der Patient seine Daten beziehungsweise den Zugang zu ihnen mittels der eGK bei sich führt. Allerdings muss es dazu eine Möglichkeit des gesicherten und einheitlichen Zugriffs geben. Patientendaten sind hochsensibel und bedürfen eines besonderen Schutzes. Nach heutigem Stand sind Cloudspeicher noch zu vermeiden. Die Voraussetzung für eine technische Anbindung an die verschiedenen Krankenhausinformationssysteme sind allerdings schwer zu erfüllen, da viele Krankenhäuser mit der Verbesserung ihrer Infrastruktur ausgelastet sind bzw. zunächst auf die abschließende Klärung offener rechtlicher Fragen zur ePA warten.
Eine alternative Option können Kommunikationsportale darstellen. Sie erlauben es, Patienten intersektoral zu versorgen. Professionals aus dem niedergelassenen Bereich und Kliniken können direkt zusammenarbeiten, ohne dass eine ePA als Transportmedium benötigt wird. Dies spart wertvolle Zeit und kann dabei helfen, die Beratung des Patienten durch mehrere Ärzte zu vereinfachen.
Auch in Krisenfällen wie Pandemien oder bei der Kommunikation zwischen Abteilungen können Patientenmanagement-Lösungen des E-Health-Sektors helfen. Die Kontrolle von Krankheitsverläufen wird erleichtert. Ausbreitungen und systematische Faktoren auszumachen und besser zu erfassen, könnte dem medizinischen Personal in Zukunft leichter fallen. Notfälle können noch schneller und präziser behandelt werden. Zusätzlich können in Fällen von stark infektiösen Krankheiten noch vor der Ankunft des Patienten Eindämmungsmaßnahmen eingerichtet werden und dank der Patientenakte eine Warnung ausgegeben werden, auch wenn dies insgesamt anonymisiert werden muss. Künstliche Intelligenz kann Mediziner durch Algorithmen, die auf digitalen Daten beruhen, besser und schnell unterstützen.
Voraussichtlich werden sich die verschiedenen ePA der Versicherer sowie kommerzieller Anbieter im Laufe der Zeit in Deutschland etablieren. Klar ist aber auch, dass zusätzliche Lösungen benötigt und genutzt werden, die an erster Stelle die Anforderungen und Uses Cases der Leistungserbringer abdecken. Insbesondere Krankenhäuser orientieren sich dazu bisher bevorzugt an den Produkten spezialisierter Anbieter für professionelle Digitalisierungslösungen. Dies gilt auch in anderen europäischen Ländern wir Österreich und der Schweiz, wo zentrale ePA mit der ELGA und dem EPD bereits etabliert sind.
E-Health-Lösungen werden uns in einem Zusammenspiel von eGK, ePA und digitalen Produkten in den Krankenhäusern in der Zukunft mit und nach COVID-19 sicher verstärkt entlasten und einen Beitrag zur weiteren Verbesserung der Gesundheitsversorgung leisten.