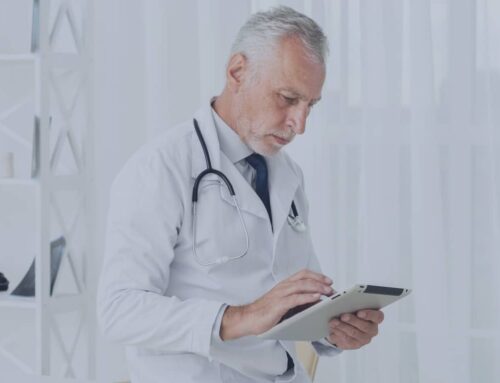Was ist eine Blockchain?
Eine Blockchain ist eine verteilte, meistens öffentliche Datenbank, die keine zentrale Kontrollinstanz hat und trotzdem bestimmte Anforderungen an Informationssicherheit erfüllt, wie Integrität und Verfügbarkeit. Neue Datensätze in der Datenbank werden als Blöcke ans Ende der vorhergehenden Datensätze eingefügt, so dass eine Art Kette entsteht. Jeder Block enthält dabei die Prüfsumme des vorhergehenden Blocks, was sicherstellt, dass die Kette nicht ohne Weiteres manipuliert werden kann. Blockchain ist vor allem durch digitale Währungen wie Bitcoin bekannt geworden. Die große Stärke der Blockchain ist, dass man keine vertrauenswürdige zentrale Instanz benötigt, welche die Blockchain kontrolliert, z.B. weil es eine solche vertrauenswürdige Instanz nicht gibt, diese politisch nicht gewollt ist, oder diese mit zu viel Kosten versehen ist.
Welche Anwendungsfälle im Gesundheitswesen gibt es?
Zu den zitierten möglichen Anwendungsgebieten gehören z.B.:
- Digitaler Austausch von Patientendaten zwischen verschiedenen Akteuren
- Management von Versicherungsfällen und Abrechnungen
- Überwachung von Lieferketten für Medikamente auf Integrität und Herkunft
- Durchführung von klinischen Studien inklusive der Bezahlung der Probanden

Sind Blockchains die Lösung für alles?
Hier einige Grenzen, welche die Anwendungsfälle einschränken:
- Die Daten in Blockchains werden auf jedem Knoten gespiegelt. Das macht das Verfahren ungeeignet für das Ablegen großer Datenmengen, z.B. für Patientenakten. Wofür es eher geeignet ist, ist das Verwalten der Zugriffsrechte auf die Akten.
- Der Zugriff auf Daten in Blockchains ist langsam, das gehört zum Design der Blockchain, um bestimmte Angriffe auf die Blockchain auszubremsen.
- Manchmal wird Interoperabilität, z.B. bei Patientendaten, als großer Vorteil der Blockchain zitiert: Dabei hat die Blockchain nichts mit Datenformaten zu tun. Interoperabilität muss auf anderer Ebene sichergestellt werden.
- Datensicherheit: Alle Daten in Blockchains sind öffentlich, und das gehört auch zum Design der Blockchain-Technologie. Bei Bitcoin bedeutet das, dass jeder die Transaktionen anderer Nutzer einsehen kann, auch wenn in anonymisierter Form. Durch statistische Verfahren kann man unter bestimmten Umständen trotzdem einen Rückschluss auf die Identität des Nutzers ziehen. Auch Verschlüsselung der Daten hilft nur zeitlich begrenzt, da Verschlüsselungsalgorithmen ein Verfallsdatum haben, bis nämlich Hardware schnell/billig genug ist, um sie zu knacken. Auch können Blockchains unter bestimmten Umständen doch manipuliert werden, d.h. die Datenintegrität verletzt werden, siehe z.B. „51%-Attacke“.
- Öffentliches Image: Solange Anwender Blockchains mit Betrugsvorfällen und Kriminalität bei digitalen Währungen in Verbindung bringen, wird es schwer, sie davon zu überzeugen, darauf basierende Anwendungen zu nutzen.
Fazit
Vieles, was die Blockchain-Technologie kann, können Datenbanksysteme schon lange abbilden. Umgekehrt machen bestimmte Szenarien, wie das effiziente Verwalten großer Datenmengen mit der Blockchain keinen Sinn. Die Blockchain wird dann interessant, wenn das Szenario auf eine zentrale Vertrauensinstanz verzichten will oder muss. Beim Thema Sicherheit ist zu bedenken: Auch wenn die Blockchain nicht absolut sicher ist, konventionelle Datenbanksysteme sind es auch nicht. Hier sind Nutzen und Risiko abzuwägen.